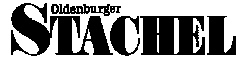
Dona Petronas Traum und Trauer
Eindrücke aus Guatemala
Guatemala ist zugleich das Schöne und das Schreckliche: ausgelassen, farbenfroh und reich an gefälliger Landschaft, dabei aber zerrissen vom längsten Bürgerkrieg Lateinamerikas, politisch unversöhnlich, sozial völlig gegensätzlich und ökologisch ausgelaugt. Die ungerechte Landverteilung ist die Hauptursache für die weitverbreitete Armut unter der Landbevölkerung. Während der größte Teil des nutzbaren Landes in den Händen einer kleinen Minderheit ist, verfügen die meisten Bauern noch nicht einmal über ein kleines Stückchen eigenes Land. Sie gleichen Fremdlingen in dem Land, das ihnen Jahrtausende gehörte und werden als Bürger zweiter Klasse in einer Nation betrachtet, die ihre Vorfahren errichteten. Die dramatische Lage läßt sich in folgenden Zahlen andeuten: 89,5 Prozent der Plantagen (sog. Mikro-Plantagen) machen 16,5 Prozent der Fläche Guatemalas aus, während 2,3 Prozent der Plantagen (sog. Makro-Plantagen) fast 65 Prozent der gesamten Landfläche umfassen und einigen wenigen Familien gehören. Der Rest verteilt sich auf eine kleine Mittelschicht.
Ich sitze in der kleinen Kapelle des Bischofshauses in Santa Cruz de El Quiché, gelegen im Norden von Guatemala an der Grenze zu Mexico. Sie ist eine Märtyrerkapelle. Unter dem Bild der Jungfrau von Guadaloupe liegt ein kleines Kästchen mit menschlichen Knochenresten. Hier wurden nicht nur die Katecheten ermordet - hier starben auch Gesundheitshelfer, Lehrer, Genossenschaftsleiter, kurz: Leute in allen möglichen verantwortlichen Positionen, insgesamt 150.000. Alle gehörten indigenen Volksgruppen an; sie sollten vernichtet werden, um der Guerilla den vermeintlichen Boden zu entziehen.
93% aller Massaker werden in den zwei Wahrheitskommissionsberichten von UNO und Kirche den Angehörigen der Armee, der Polizei, den Zivilpatrouillen und Todesschwadronen zur Last gelegt. Bischof Julio Cabrera-Ovalle erläutert uns das hinter den Menschenrechtsverletzungen stehende Denken: "Wer Menschen organisierte, der galt als verdächtig; wer zudem katholisch war, der hatte mit der Guerilla zu tun"
Im August diesen Jahres nahm ich an einem Exposure- und Dialogprogramm in Guatemala teil. Für eine kurze Zeit setzte ich mich einer völlig anderen Lebenswelt aus, teilte den Alltag meiner Gastgeber auf dem Lande, hörte ihre Lebensgeschichten, schlief und aß in ihrer Hütte - ohne fließendes Wasser, Strom, Toilette, zusammen mit acht Personen und Haustieren in einem Raum. Daher die Bezeichnung Exposure, von to expose (engl) = sich aussetzen.
Ich erzähle die Geschichte von Dona Petrona, in deren Familie ich gelebt habe. Sie ist eine 43 Jahre alte Frau. Sie wohnt in der Ortschaft Nebaj, in dem sich der bewaffnete Konflikt mit seinen ganzen Schrecken und Scheußlichkeiten abspielte.
Dona Petrona heiratete 1981 Don Miguel. Beide hatten drei Kinder. Sie führten ein sehr einfaches Leben, bauten Mais an, hatten einige Tiere und trachteten danach, in den Zeiten des Bürgerkrieges und unter der Präsenz des Militärs einfach nur zu überleben. Don Miguel leitete zusammen mit seinem Freund Don Juan die katholische Gemeinde. Sie riefen die Leute zum Gottesdienst und zum Lesen des Evangeliums zusammen. Sie hielten eine Gemeinde am Leben, in der Bewußtseinsbildung geschah, in der überlegt wurde, wie etwas verändert werden könnte. Und sie taten dies der fundamentalistischen Sektenwerbung des damaligen Staatspräsidenten Efraim Rioß Montt zum Trotz.
Am 11.3.1985, so erzählt uns Dona Petrona, kam plötzlich das Militär morgens in die Hütte und verhaftete ihren Mann. Er wurde in die nahegelegene Polizeistation gebracht und gefoltert, um von ihm Informationen über Standorte der Guerilla in den Bergen zu bekommen. Solche Informationen konnte Don Miguel nicht geben, da er und seine Gemeinde sich bewußt gegen eine Teilnahme an Guerillatätigkeiten entschieden hatte. Die Soldaten schlugen ihm schließlich mit der Machete seine Fußsohlen auf und zwangen ihn, einen schweren Militärrucksack zu einer weiteren Militärstation zu tragen. Dort setzte sich das Verhör die ganze Nacht über fort. Zeugen hörten sein Schreien. Man schlug ihm einzeln die Zehen ab, man hackte ihm die rechte Hand ab, man drückte ihm ein Auge ein.
Am nächsten Tag, dem 12. März 1985, erschoß man ihn schließlich und warf seine Leiche auf einen Seitenweg des Dorfes, wo ihn Zeugen so zugerichtet sahen. Die Anordnung wurde erteilt, daß ihn niemand begraben dürfe. Abschreckung war das Ziel. Die Soldaten überwachten den Straßenzug. Wer sich der Leiche näherte, wurde angeschossen. 14 Tage lang lag die Leiche auf dem Weg. Tiere fraßen sie an. Dann gelang es einem Freund der Familie schließlich, Don Miguel zu begraben - allerdings nur wenig unter der Erde, da alles unter ungeheurem Zeitdruck zu geschehen hatte.
Dona Petrona war fortan alleine zuständig für ihre drei Kinder, von denen heute nur noch die älteste Tochter lebt. 1987 ging sie eine neue Beziehung mit Don Juan, dem Freund ihres Mannes ein. Aus dieser Beziehung gibt es fünf Kinder zwischen vier und 14 Jahren. Die Familie mußte in die sogenannten "zivilen Widerstandsdörfer" gehen, wo sie in den ersten Jahren in den Wäldern immer in der Hut vor der Armee leben mußte - ohne jegliches Hab und Gut, oftmals ohne Kalk und Zucker zum Weichkochen des Mais, ohne Medikamente - ein Nomadenleben ohne feste Hütte. Man lebte von Wurzeln und Kräutern und dem, was man in den Bergen fand. Im "Widerstandsdorf" lebten sie zwölf Jahre lang. Dies wurde von der Öffentlichkeit Guatemalas und der Welt nicht wahrgenommen und lange nicht anerkannt als "zivile" Form von Widerstand. Seit einem Jahr lebt die Familie in einer Hütte, in der wir sie besuchten.
Am 27.7.2001, eine Woche vor unserer Ankunft, wurde das neunte Exhumierungsprogramm der Diözese El Quiché in Nebaj mit einem feierlichen Requiem durch den Bischof abgeschlossen. Das Ausgraben geheimer Friedhöfe war nach dem Friedensabschluß von 1996 zwischen Militär und Guerilla möglich geworden. Unter den 122 exhumierten Personen aus 72 geheimen Gräbern in 23 Dörfern (58 Männer, 29 Frauen und 33 Kindern; man fand auch die Gebeine eines Ungeborenen, das dem Leib seiner Mutter entrissen worden war) befand sich auch der erste Mann von Dona Petrona, Don Miguel. In seinem Grab fand man nur noch den Schädel und die Knochen seines rechten Beines. Das Grab war von den Tieren des Waldes aufgewühlt worden, und die Knochen waren fortgetragen worden.
In der Hütte, in der wir zusammen mit der Familie schliefen, hatte ein Holzsarg mit seinen Knochenresten gestanden. "Heimgekommen" war er - ein wichtiges Ritual für die Indigenas -, bevor er dann von den Seinen würdig begraben wurde. Sein Bild hing an der Wand, umrahmt von Jesus- und Maria-Bildern. Vor dem Bild wurden abends Kerzen angezündet, die nicht allein zur Erleuchtung des Raumes dienten.
Dona Petrona erzählte uns von der Nacht nach dem Begräbnis: Im Traum begegnet ihr Don Miguel. Er sagt zu ihr: "Es ist schön, daß du mich nicht vergessen hast und mich in dein neues Haus geholt hast. Es ist gut, daß du mit Don Juan zusammen bist und daß du fünf Kinder mit ihm hast. Was hättest du auch anderes machen sollen" Du kannst nicht alleine bleiben. Ich weiß, daß du mich immer noch gerne hast; ich habe dich auch immer noch gern. Es ist alles gut, wie du es gemacht hast!"
Und viele Frauen erzählten ähnliche Träume.
Diese Lebensgeschichte ist mir sehr nachgegangen. Mir wird deutlich: Wer soviel an Gewalt, an Zerstörung und Vernichtung erfahren hat, der kann sich nicht damit aufhalten, sich selber nur die eigene Zukunftslosigkeit zu beschreiben. Mit solcher Rede allein kann man nicht leben, konnte man nicht überleben in den Wäldern. Ich lerne: das Leben geht nur, wenn man redet und wenn man handelt, als ob es ginge. Die Leute haben einen ungeheuren Lebenswillen, haben eine tiefe Sehnsucht nach Leben.
Was mich überrascht: Ich höre wenig von Haß und Rache. Die Indigenas sind tief religiös; sie legen ihr Leben "in Gottes Hände". Eine solche Haltung ermöglicht es, Rachegefühle zu verwandeln. Und sie haben auch die Fähigkeit zu verstehen, daß einige Täter nur unter Zwang so handelten, daß also die Ausführenden nicht die unmittelbar Verantwortlichen waren. Und dieses Wissen hat sie fähig gemacht zu verzeihen. Gleichwohl fehlt die Bitte der Täter um Vergebung fast gänzlich; sie gehören den sog. Sekten an, die gegen Versöhnung sind.
Ich sehe: Menschen, die den Finger auf die eigentlichen Wunden legen und dabei unweigerlich die Gesellschaftsstrukturen und die Landverteilung berühren, leben gefährlich. Sie brauchen internationalen Rückhalt durch Strukturen der Solidarität.
Ich erkenne: die Christen sind die ältesten und größten "global players"; global ist kein Fremdwort, wir haben damit eine zweitausendjährige Tradition. In Zeiten heutiger Globalisierung wächst den Christen die Aufgabe zu, für eine Globalisierung der Solidarität nächste Schritte zu setzen und zu erfinden. Und das heißt Dialog und Begegnung, damit wir umeinander und voneinander wissen. Es geht nicht an, ökonomisch global zu denken und zu handeln, politisch multilateral, kirchlich und moralisch aber provinziell.
Klaus Hagedorn
als Pastoralreferent Hochschulseelsorger an der Universität in Oldenburg, Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuß der Konferenz für Kath. Hochschulpastoral und hier verantwortlich für ein "Nord-Süd-Dialogprogramm" in der Hochschulpastoral auf Bundesebene.