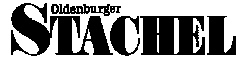
Von den Freuden eines Lebens in der Innenstadt
"Wo wohnen Sie?" - "Achternstraße." - "Oh Gott! Ist das nicht furchtbar? Wo genau in der Achternstraße?" - "Am Markt." - "??? Nun ja, immerhin zentral."
Daß die Wohnstatt auf den Ämtern von Interesse ist, leuchtet ein. Daß die Lage der Behausung selbst im Hotel weitschweifig kommentiert wird, scheint allerdings schon bemerkenswert. Wohnt man in der Oldenburger Innenstadt, also mittendrin, erntet man garantiert derartiges Interesse. Gelegentlich begegnet einem sogar verblüfftes Staunen, verbunden mit der vielsagenden Feststellung: Da wohnt doch eigentlich keiner mehr. Oder noch besser:
Kann man da auch wohnen?
Gute Frage. Es ist zwar wie in anderen Städten so, daß massenweise leerstehende Büroflächen aus Spekulationsgründen lohnenswerter erscheinen als genutzter Wohnraum, doch wohnen hier und da tatsächlich noch welche in der Innenstadt. Freilich nicht so viele, wie da wohnen könnten, aber ein paar sind es schon noch. Vermutlich verstellt der Parterre-Blick, der den Fußgängern in der Zone eigen ist, diese Wahrnehmung. Und angesichts der Wohnlandschaft in Oldenburg, angesichts der zentrumsnahen, teilweise idyllischen Viertel Ziegelhof, Donnerschwee, Osternburg oder gar Dobben mag es wenig wünschenswert erscheinen, in der Fußgängerzone zu hausen. Denn hier kann man sein Auto nicht vor dem Haus parken, sondern muß es entweder eine gute Fußstrecke entfernt oder zu sündhaften Preisen in einem Parkhaus abstellen. Erst recht kann man nicht jederzeit vorfahren und was auch immer aus- oder einladen. Selbst das Fahrrad muß eine Weile geschoben werden, bevor man in den Zustand des Fahrens übergehen kann. Kein privates Refugium, das durch einen Zaun, eine Einfahrt oder einen Vorgarten vor der Außenwelt geschützt wird.
Gilt andernorts diese Wohnlage als besonders erstrebenswert und nachgerade prestigeträchtig, hält der typische Oldenburger nicht viel davon, in der Fußgängerzone zu wohnen. Lange habe ich mich darüber gewundert, jetzt weiß ich, warum.
Es muß, abgesehen von den Junkies mit ihrem regen Sozialleben und vielleicht den agilen Jugendbanden, die fachmännisch betreut und überwacht von einem zentralen Platz zum nächsten umsiedeln, an den Männern liegen, die meinen, ihre Notdurft nur vor der Haustür eines Innenstadtbewohners verrichten zu können. Sie zeigen sich dabei auch erstaunlich resistent gegenüber allen Anfechtungen. Erwiesenermaßen kann man als Betroffener direkt neben dem Bedürftigen stehen und ihn auf sein Tun ansprechen, es hindert ihn nicht daran, die Tür, durch die man im nächsten Moment gehen möchte, erst einmal zu markieren. Es ist müßig, über archaische Triebe oder simple Notwendigkeiten nachzudenken: Die Geruchs-Melange aus Bier und allen erdenklichen körperlichen Ausscheidungen läßt einen täglich darüber nachdenken, wie es wäre, nicht in der Innenstadt zu wohnen.
Die Anlässe, wo dieses Phänomen intensivst zu studieren ist, die wichtigsten Oldenburger Stadtszenarien des Jahres, sind nun fast überstanden. Der Kramermarkt ist erledigt, so daß wir nurmehr dem Weihnachtsmarkt gefaßt entgegensehen müssen. Es war von unschätzbarem Vorteil, daß sich die Stadtoberen nicht dazu hinreißen ließen, den Kramermarkts-Sonntag als verkaufsoffenen zu deklarieren. So hatte man es nur mit den Bierdosenkickern in der Nacht zu tun.
Das Stadtfest und der Weihnachtsmarkt stellen aus der Sicht derjenigen, die auf den Trampelpfad und die Schaufenster herunterschauen, unbestreitbar die Höhepunkte des Jahres dar. Wer kann, verkrümelt sich. Es ist nicht nur auffällig, sondern bezeichnend, daß während des geschätzten Kultursommers, dessen Veranstaltungen sich immerhin über einen längeren Zeitraum hinziehen, keineswegs solche Entgleisungen zu beobachten sind wie im Verlauf der von der Geschäftswelt geförderten und begrüßten Festlichkeiten. Tausende von Menschen lauschen auf dem Schloßplatz den Konzerten, ohne daß es zu Ausschreitungen kommt oder die Haustür zur öffentlichen Toilette degradiert wird. Nebenbei bemerkt: Man muß nicht kulturbeflissen sein, um es ungerecht und unverständlich zu finden, daß die wirklich hörenswerte Musik der Kultursommerveranstaltungen um Punkt 22 Uhr zu verstummen hat, egal wie begeistert das Publikum ist, während das unsägliche, stereotype und nervtötende Gedudel beim Stadtfest bis tief in die Nacht fortdauern darf.
Es gilt hier wie immer, wenn es die Innenstadt betrifft, die goldene Regel: Priorität haben die Geschäftsinteressen. Der Rubel muß schließlich rollen. Deswegen auch ist es unendlich wichtig, per Sondereinsatzkommando Graffiti-Sprüher zu verfolgen. Sauberkeit fördert das Geschäft. Den Dreck, der im Zuge konsumstimulierender Stadtfeste entsteht, entsorgen städtische Reinigungskräfte oder private Putzen zum Billigtarif, sang- und klanglos, denn es wurde wenigstens Kasse gemacht. Die Feste sollen ein vitales Leben in der Innenstadt demonstrieren, wovon diejenigen, die dort leben, nicht so viel halten.
Denn es läuft in aller Regel auf eine Invasion hinaus, einem Sturm auf das Zentrum, das als öffentlicher Raum begriffen wird, in jeder Weise zu nutzen. Öffentlich ist nicht privat, ist sogar das Gegenteil davon. Und weil die Fußgängerzone nurmehr als öffentlicher Raum verstanden wird, der keinem, nicht einmal der Allgemeinheit gehört, kann man sich dort auch benehmen wie man will. Keine Frage, daß manche von denen, die Haustüren und -eingänge mit öffentlichen Toiletten verwechseln, über ihr privates Reich mit Entschlossenheit wachen und zum Äußersten bereit wären, sollte ihr Personenkraftwagen auf dem Parkplatz besudelt werden.
Während diese Saubermänner schlicht ignorieren, daß hier gelebt wird, tun die Sprayer im übrigen keineswegs so, als sei das Zentrum eine Industriebrache. Ihre Spuren dokumentieren das Gegenteil, tun keinem, der hier wohnt, sonderlich weh und wirken darum auch nicht so verächtlich.
Daß die Innenstädte, wie häufig geklagt wird, veröden, liegt an der Monokultur, genannt Konsum, und der Tatsache, daß diese Zwecksetzung im öffentlichen Bewußtsein zementiert ist. Die letzte mögliche Steigerung wäre es, die Fußgängerzone außerhalb der Ladenöffnungszeiten und Festivitäten abzuriegeln.
Wohlgemerkt: Man kann hier wohnen und sich wohl fühlen, sofern man keine dörfliche Abgeschiedenheit und Ruhe erwartet. Die Gesangseinlagen, in deren Genuß man allabendlich kommt und die wohl in irgendeinem Zusammenhang mit der beeindruckenden Zahl Oldenburger Singvereine stehen, sind kein Ärgernis. Gespräche und Gelächter sind durchaus nicht unerwünscht und die lautstarken Einsätze militärischer Stoßtrupps auf Ausgang lassen sich ebenso überleben wie die frenetischer Fußballfans. Man gewöhnt sich selbst an die herzhaften Streitigkeiten, deren Zeuge man werden darf. Rennt man zunächst noch ans Fenster in der bangen Erwartung, die Fußgängerzone werde zum TATORT, brüht man mit der Zeit ab und zieht Nutzen aus der Sache, weil der Schlagabtausch auch den persönlichen Wortschatz erweitern kann. Erkenntnisse über das Konsumverhalten bundesdeutscher Kunden oder familien- und beziehungsinterne Verhaltensmuster werden hier frei Haus geliefert. Das alles gehört zum Innenstadtleben wie die pausenlose, stereotype Beschallung durch Bänkelsänger und Musikanten - auf der Liste der Top Ten steht das nie vergessene Ave Maria ganz, ganz oben - " der Lieferverkehr des nächtens und die ausdauernde Stadtreinigung um halb Sieben. Das alles berührt aber auch nicht so sehr das eigene Empfinden, dringt nicht so sehr ins Private ein, das in dieser Gesellschaft ja nun einmal sakrosankt sein sollte, wie der Mann an der Haustür oder besessene Kunden, die meinen, ein Hintereingang sei im Grunde genommen auch nur ein Ladeneingang.
Wer zur Fraktion "Ruhe und Ordnung" gehört, sollte nicht in der Innenstadt leben, weder in Oldenburg noch anderswo. Es wäre allerdings schon viel gewonnen, wenn der sich dann im Zentrum ebenso benehmen könnte wie zuhause.
va
Diese Veröffentlichung unterliegt dem Impressum des Oldenburger Stachel. Differenzen zur gedruckten Fassung sind nicht auszuschließen.
Nachdruck nur mit Quellenangabe, Belegexemplar erbeten.