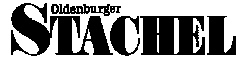
Rose 12 zur Vertreibung der Drogenszene:
Mehr Brutalität und Kriminalität als vorher
Die im City-Management zusammengeschlossene Kaufmannschaft forderte die Stadt auf, den Hartdrogenhandel aus der Fußgängerzone zu verbannen und so ihre bisherige Attraktivität wiederherszustellen. Seitdem vertreiben offensichtlich Ordnungsamt und Polizei Drogenhändler und -konsumenten, aber auch andere Menschen, die mit ihnen im Kontakt angetroffen werden, mit massiven Methoden aus der Innenstadt: Regelmäßige Polizeikontrollen, Einsätze mit bis zu 20 Beamten, erkennungsdienstliche Behandlung, Platzverweise, Aufenthaltsverbote, Geld- und Gefängsnisstrafen nach wiederholtem Antreffen haben die Drogenszene auf dem Rathaus- und Waffenplatz inzwischen vollständig atomisiert und in alle Stadtteile zerstreut. Gleichzeitig werden immer mehr brutale Übergriffe von Drogenabhängigen gemeldet. Der STACHEL sprach mit dem Streetworker und Mitarbeiter der Rose 12, Winfried Wigbers, über Sinn und Unsinn der Vertreibungspolitik von Polizei und Ordnungsamt.
Nicht erwähnt in dieser ganzen Diskussion bleibt die größte Masse der Drogenabhängigen, die ca. drei Millionen deutschen suchtkranken Alkoholiker. Der Handel mit der Droge Alkohol bleibt auch in der Oldenburger Innenstadt weiterhin erlaubt, Händler und Konsumenten werden von der Stadtverwaltung zuvorkommenst behandelt. Die Wallstraße ist trotz der regelmäßigen Exzesse der zahlreichen Konsumenten noch nicht abgesperrt worden. Und doch versursacht die Droge Alkohol hundertmal mehr Tote als alle anderen Drogen zusammen...
Mit Winfried Wigbers sprach J. Sohns.
Vorgeschichte
Stachel: Wie ist es zu der heutigen Situation in der Innenstadt gekommen?
W. Wigbers: Im November 1997 entwickelte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt ein neues Konzept zum Umgang mit Drogenabhängigen in der Innenstadt: Durch Platzverbote sollten diese von ihren Treffpunkten in der Fußgängerzone vertrieben werden. Grundlage für das neue Vorgehen war das von Innenminister Glogowski initiierte "Gefahrenabwehrgesetz" nach den "Chaostagen" in Hannover. Offiziell hieß es, daß bei Verdacht gegen Dealer auf dem Rathausplatz vorgegangen werden sollte. In der Realität richtete sich diese Vertreibungsaktion auch gegen die Konsumenten und gegen die Menschen, die mit ihnen in Kontakt angetroffen wurden.
Als erstes erfolgte ein Platzverweis für 24 Stunden. Bei Zuwiderhandlung wurde ein Innenstadtverbot für ein bis vier Wochen ausgesprochen. Sehr schnell wurden dann "Ordnungsstrafen" von 500 Mark verhängt. Da diese in der Regel nicht bezahlt wurden, wurde eine Inhaftierung angeordnet. Der Erfolg dieser Maßnahmen: innerhalb einer Woche war der Rathausmarkt frei von Drogenabhängigen.
Szene als Familienersatz
Die Szene war nun völlig verunsichert. Sie suchte neue Treffpunkte. Wer dazu in der Lage war, traf sich privat mit anderen. Das können jedoch nur Abhängige, die noch in strukturierten Zusammenhängen leben. Die völlig Desintegrierten haben diese Möglichkeit nicht. Ohne die Szene haben sie aber ihren letzten Halt verloren. Die Szene ist ihnen gleichzeitig Familie und Arbeitsplatz.
Stachel: Was tat die Szene also nach der Vertreibung vom Rathausplatz?
W. Wigbers: Anfangs traf sie sich beim Arbeitsamt wieder, dann beim Bahnhof. Doch in kurzer Zeit kam sie wieder auf dem Waffenplatz zusammen. Dort hatten sich vorher "Hascher" und Substituierte aufgehalten. Auf diesem neuen Treffpunkt ging es zuerst normal weiter. Nachdem in den ersten Tagen vorsichtig gedealt und gebunkert worden war, entwickelte sich die Szene bis zum Januar 1998 wie auf dem Rathausmarkt. Ich konnte wieder normal Straßenarbeit machen und die Leute ansprechen. Zwischendurch waren sie ja in alle Winde zerstreut gewesen.
Vertreibung vom Waffenplatz
Ende Februar jedoch griff die Polizei dort ebenso massiv ein wie auf dem Rathausplatz. Es erfolgten Einsätze mit bis zu 20 Polizisten. Alle Leute wurden mitgenommen, sogar welche, die gerade mit mir im Gespräch waren. Sie wurden einfach aus dem gespräch heraus- und mitgenommen. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und erhielten Platzverbote.
Drei Wochen später war die Polizei regelmäßig mit Doppelstreifen auf dem Waffenplatz präsent. Neuerlich angetroffene Drogenabhängige erhielten ein langfristiges Innenstadtverbot oder wurden inhaftiert. Jetzt ist auch der Waffenplatz "frei".
Doch die Drogenabhängigen laufen durch die Innenstadt und suchen das, was sie bisher in der Szene fanden: Handel und Kontakt mit anderen Menschen, Informationen und Gespräche, z.B. über die Beschaffenheit eines Stoffes, über Schlafplätze, Waschmöglichkeite n... Das fällt jetzt weg. Heute sind sie völlig vereinzelt ohne sozialen Kontakt. Deshalb sind sie jetzt viel aggressiver...
Stachel: Aggressiver untereinander oder gegen andere?
W. Wigbers: Erst einmal untereinander, aber dann auch gegen andere. Die Polizei und das Ordnungsamt erzeugen ja einen unglaublichen Druck von außen. Den geben die Drogenabhängig en, soweit sie können, weiter nach innen in die Szene, in der sie sich noch bewegen können. Das ist wie in der Familie, wo der von außen bedrängte Patriarch dann Frau und Kinder terrorisiert.
Szene als Regulativ gegen Brutalität
Doch auch gegen andere Opfer wird der Druck weitergegeben. Alte hilflose Frauen mit Handtaschen z.B. werden überfallen. So wächst die Kriminalität, Überfälle und Brutalität nehmen zu. Die intakte Szene hat so etwas vorher verhindert.
Stachel: Die Szene hat vorher das Anwachsen von Gewalt und Kriminalität verhindert?
W. Wigbers: Ja, die Szene ist auch ein Regulativ. Sie einen Codex, der gewisse Grenzen zieht. Z. B. würde die Szene es verurteilen, daß an fünfzehnjährige Mädchen Heroin verkauft wird. Somit verhindert sie es auch. Denn wer so etwas macht, wird zum Außenseiter. Und manche Desintegrierte sind vollständig auf die Szene angewiesen.
Nach der Vertreibung der Szene von ihren Treffpunkten macht sich bei diesen nun die Stimmung breit: "Wir haben sowieso nichts mehr zu verlieren!" Denn sie haben mit der Szene jetzt den letzten Halt verloren. Was an Aggression in die Gruppe der Drogenabhängigen reingeht, kommt auch wieder raus - an allen möglichen Stellen in Oldenburg. Wo, ist nicht vorhersehbar, und die Drogenkonsumenten sind sehr schwer aufzufinden und anzusprechen. Sie wissen nicht mehr, wohin, sie können keinen Einfluß mehr darauf nehmen, wo sie sich aufhalten und treffen sollen.
Die Polizei sagt, sie gehe nur gegen Dealer vor und setze sich für die Erhaltung der Attraktivität Oldenburgs ein. Wir sind auch dagegen, daß Oldenburg zum Drogenhandelszentr um wird. Doch real zerschlägt die Polizei Strukturen, die sinnvoll sind. Sie produziert Situationen, die viel schwerere Kriminalität als vorher hervorbringen. Diese Arbeit der Polizei ist kontraproduktiv. Überall in Deutschland wurde solch eine Politik nach spätestens einem Jahr wieder aufgegeben. Die Schäden sind viel größer als die Erfolge.
Stachel: Wie sieht das Gegenkonzept der Rose 12 aus?
W. Wigbers: Die Bedingungen unserer Arbeit haben sich beständig verschlechtert, und dies seit Jahren. Seit 1977 arbeiten wir mit zweieinhalb Stellen. Doch die Situation ist heute eine völlig andere als damals.
Mehr Hartdrogen - weniger Geld für Rose 12
Während wir 1977 ca. 200 "Kiffer" betreuten, zählten wir 1996 in unserer Klientel 888 Menschen, die Hartdrogen konsumierten. Seit 1977 hat sich der Finanzierungsbeitrag der Stadt Oldenburg um keinen Pfennig erhöht, wohl aber sind wie überall Kosten und Tarife gestiegen. Und während wir damals für drei Jahre 200.000 DM vom Land erhielten, sind diese Zuschüsse heute gestrichen. Damals konnten wir davon den niedrigschwelligen Arbeitsbereich bezahlen, den mußten wir aber nun aufgeben. Die Teestube in der Heiligengeiststraße mußten wir schließen. Nur ein winziger Aufenthaltsraum ist für unsere Besucher geblieben.
(Herr Wigbers zeigt mir einen kleinen Raum im Haus Alexanderstraße 17, in dem gerade mal drei winzige Tischlein mit je vier Stühlen stehen können.)
W. Wigbers: Hier drängen sich während der Besuchszeiten die Leute wie die Heringe, sie sitzen und stehen dicht an dicht. Wenn wir hier auch noch wie bisher das Kickerspiel aufstellen würden, könnten gar nicht mehr alle rein. Ein Ansprechen und Gespräch ist so absolut unmöglich.
Es brennt!
Das Land ging bei seinem Zuschuß davon aus, daß die Stadt diesen Anteil langfristig übernehmen würde. Doch nun wird uns von allen Seiten in Oldenburg signalisiert, daß wir froh sein können, daß die bisherigen städtischen Zuschüsse nicht auch noch gekürzt würden. Aber das reicht hinten und vorne nicht, und erst recht nicht können wir so ausreichend auf das Anwachsen des Hartdrogenkonsums reagieren! Es brennt, es brennt! Und unsere ganz kurzfristige Forderung ist, daß wir andere Räumlichkeiten bekommen und personell in die Lage versetzt werden, das niedrigschwellige Angebot wieder einzurichten. Die Drogenkonsumenten müssen wieder bessere Möglichkeiten haben, uns zwanglos aufsuchen zu können, und wir müssen besser in die Lage versetzt werden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. So konnten wir früher eine Kleiderkammer, eine Möglichkeit zum Wäschewaschen, Notschlafplätze, Abendöffnungszeiten und ein warmes Abendessen anbieten.
Stachel: Was würde solch ein Angebot ungefähr kosten?
W. Wigbers: Das würde ungefähr 20.000 bis 30.000 DM pro Jahr für die Sachkosten erfordern. Ein erster Schritt zu einem richtigen Konzept für die Drogenpolitik wäre also, die Zugangsschwelle zu den betreuenden Einrichtungen zu senken und möglichst nierdrig zu halten. Das würde aber eine zusätzliche Sozialarbeiterstelle erfordern, die von der Stadt finanziert werden müßte. Das ist nötig, um auf die neue Situation in der Drogenszene überhaupt erst mal ausreichend reagieren zu können. Im Moment ist nur eine "Rumpfarbeit" möglich...
Stachel: Die Stadt spricht davon, daß jetzt ein Drogenhilfeplan erarbeitet werden soll.
W. Wigbers: Ja, für vielleicht 15.000 bis 20.000 DM ist Professor Meyenberg an der Uni beauftragt worden, zu forschen, was ein Drogenhilfeplan der Stadt beinhalten müßte. Doch die Ergebnisse werden nicht vor Ende des Jahres vorliegen, und das ist zu spät! So lange darf die Stadt nicht abwarten! Um die aktuelle Notsituation zu lindern, ist es sofort erforderlich, das niedrigschwellige Betreuungsangebot zu verbessern. Dazu ist die menschenverachtende Politik der Vertreibung keine Alternative.
Stachel: Vielen Dank für das Gespräch.
Diese Veröffentlichung unterliegt dem Impressum des Oldenburger Stachel. Differenzen zur gedruckten Fassung sind nicht auszuschließen.
Nachdruck nur mit Quellenangabe, Belegexemplar erbeten.